Leseprobe: Kiss & Swallow – Reapers of Sothom 1
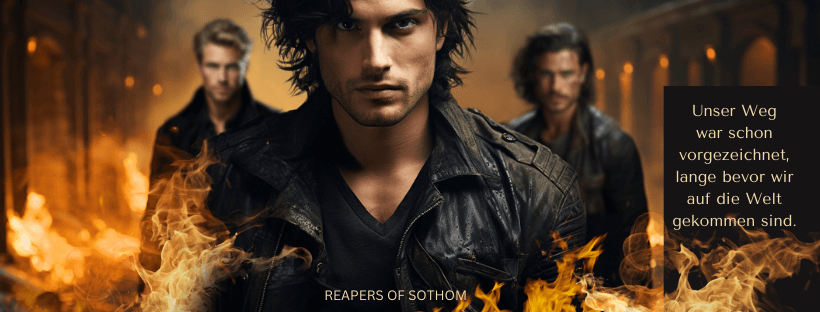
KAPITEL 1
Federica
Zwei Jahre zuvor
»Wach auf!« Jemand rüttelt an meiner Schulter. »Komm schon! Wir müssen verschwinden!«
Von einer Sekunde zur nächsten bin ich hellwach. Ich nuschele nicht verschlafen: Was’n los? Ich wälze mich nicht herum und vergrabe auch nicht mein Gesicht ins Kissen. In meinem Verstand wird sofort der Schalter auf Betriebsmodus umgelegt und ich setze mich auf. Ein Reflex, den ich mir über die Jahre angewöhnt habe – aus Gründen.
Meine Mutter zieht die Bettdecke fort. Kälte streicht über meine bloßen Gliedmaßen. »Hoch mit dir! Pack nur das Nötigste ein. Sie sind schon auf dem Weg hierher.« Sie schaltet die Lampe auf dem Nachttisch an, die eine hängende Lilie aus buntem Glas darstellt. Ich mag diese Lampe, auch wenn sie unfassbar kitschig ist.
Ich schwinge die nackten Füße auf den angenehm beheizten Fußboden und wünschte, ich könnte die Wärme noch ein wenig länger genießen. Doch meine Mutter hat bereits meinen Rucksack entdeckt, der an der Lehne meines Schreibtischstuhls hängt, und wirft ihn mir zu. »Nur das Allernötigste«, wiederholt sie und hastet zum Fenster, um den Vorhang ein winziges Stück zu öffnen und auf die nächtliche Straße zu spähen.
Ich habe gelernt, in solchen Momenten keine Fragen zu stellen, doch diesmal ist etwas anders. Ich weiß nicht genau, was, aber darüber kann ich mir später noch den Kopf zerbrechen. Hastig ziehe ich mich an – Jeans, T-Shirt, meinen übergroßen warmen Lieblingspullover – und stopfe Unterwäsche, Pullover, meine Lederrolle mit dem Schnitzwerkzeug und zwei ungelesene Taschenbücher in den Rucksack.
Ich will gerade mein Tablet in die Seitentasche schieben, da dreht sie sich zu mir um. Ich erstarre mitten in der Bewegung.
»Oh Gott, was ist passiert?«, flüstere ich.
Für einen winzigen Moment glaube ich, eine Fremde vor mir zu haben. Nicht wegen der Platzwunde am Kinn, die sie vor mir zu verbergen versucht. Auch nicht, weil sie leichenblass ist und ihre Augen wie riesige Löcher wirken. Ihre Lippen zittern, auf ihrer goldfarbenen Bluse sehe ich einige rote Flecken, das linke Ohrläppchen ist durchgerissen. Vor einigen Stunden hing noch ein Diamanttropfen daran. Ihr sonst so akkurat frisiertes Haar sieht aus, als hätte sie sich am Boden gewälzt, ihre elegante Stoffhose ist am Knie eingerissen und schmutzig.
Doch es ist der Ausdruck auf ihrem Gesicht, der mir einen Mordsschrecken einjagt.
Meine Mutter hat Todesangst.
Diese Erkenntnis schnürt mir die Kehle zu. Meine Mutter hat nie Angst. Nie. Es gibt nur eine Sache im Leben, auf die ich mich verlassen kann: Nichts und niemand kann meine Mutter jemals einschüchtern.
Dachte ich.
»Dein Tablet muss hierbleiben«, sagt sie, meine Frage ignorierend, und nimmt mir das Gerät aus der Hand.
»Dein Ernst? Weißt du, wie lange ich für dieses Ding gespart habe?« Ich weiß, dass ich mich wie ein quengelndes Kind anhöre, aber der Schock sitzt tief in meinen Eingeweiden. Die lange Narbe zwischen meinem Ring- und Mittelfinger beginnt zu jucken, was nie ein gutes Zeichen ist.
»Tut mir leid, aber sie könnten es orten.«
»Wer ist sie? Hast du dich mit dem falschen Mann angelegt?«, frage ich, während ich meine Sneakers schnüre. »Du hast versprochen, dass du nie wieder …«
»Nicht jetzt, Süße, bitte«, zischt sie und schaltet die Nachttischlampe aus. Draußen streichen Scheinwerferlichter über die Magnolie im Vorgarten; meine Mutter erstarrt. Das Fahrzeug fährt weiter, doch ihre Gestalt entspannt sich nicht.
»Kommen wir wieder hierhin zurück?« Dieses Apartment gehört uns. Sie hat gesagt, dass wir hier bleiben werden. Für immer. Ich hatte vorher noch nie ein festes Zuhause. Es gefällt mir hier, auch wenn es keine sehr große Wohnung ist. Verdammt, ich habe sogar Zukunftspläne geschmiedet! »Mom? Kommen wir zurück?«
Statt zu antworten, huscht sie aus dem Zimmer. Ich höre ihre leisen, schnellen Schritte in der stockdunklen Diele.
Ich greife meinen Rucksack, zögere und schaue mich um. Auf den Regalen blicken mich meine geschnitzten Figuren stumm an. Das Kribbeln meiner Narbe verwandelt sich in ein unerträgliches Brennen und eine dunkle Vorahnung befällt mich. Wir werden nicht zurückkehren.
Hastig schaue ich zur Zimmertür, bevor ich auf die Knie falle und das kleine zerbeulte Blechkästchen hervorhole. Es wird von einem breiten Gummiband zusammengehalten, auf dem Deckel ist ein Bild von Rotkäppchen und dem bösen Wolf zu sehen. Die Farbe blättert bereits ab. Ich stopfe das Kästchen tief in den Rucksack, bevor ich in die Diele husche und meine Schaffelljacke von der Garderobe pflücke.
Meine Mutter hat die Wohnungstür einen Spalt weit geöffnet und lauscht in den stillen Hausflur. Es ist mitten in der Nacht; sämtliche Nachbarn im Haus schlafen tief und friedlich.
»Der Wagen ist vorbeigefahren«, wispert sie. »Ich habe mein Auto in der Einfahrt der Bäckerei gegenüber abgestellt.«
»Warst du heute Abend bei Onkel Luther?«
Ich habe nicht gehört, wann sie nach Hause gekommen ist. Luther wohnt mindestens eine Autostunde von hier entfernt und normalerweise übernachtet sie in seinem Gästezimmer, wenn sie ihn besucht. Sie fährt nicht gern im Dunkeln.
Ohne mir zu antworten, hastet sie über die leere Straße, die nur unzureichend von einer einzelnen Laterne beleuchtet wird. Ich muss rennen, um zu ihr aufzuschließen. Sie hat lediglich ihre kleine Handtasche von Hermés bei sich. Nicht einmal ihren neuen Kaschmir-Mantel hat sie angezogen, obwohl es frostig kalt ist.
Sie taucht in die unbeleuchtete Hofeinfahrt neben der Bäckerei ein. Niemand außer uns ist zu hören oder zu sehen, kein Motorengeräusch nähert sich. Sie drückt die Fernbedienung des Schlüsselanhängers und zuckt zusammen, als die Scheinwerfer bestätigend aufleuchten.
Luther ist ihr älterer Bruder, aber ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Bis vor Kurzem habe ich nicht einmal gewusst, dass er existiert. Sie hat ihn nie auch nur mit einem Wort erwähnt.
Nun, sie redet auch nicht über den Rest unserer Familie. Vor zwei Monaten war ich überzeugt, dass besagte Familie nur noch aus meiner Mutter und mir besteht. Meine Großeltern waren tot, mein Vater wurde nie erwähnt, außer im Zusammenhang mit dem Wort Arschloch, und Geschwister habe ich nicht. Plötzlich ploppt da ein Onkel auf, von dessen Existenz ich nichts gewusst habe, doch bevor ich auch nur einen Blick auf ihn erhaschen kann, sind wir auf der Flucht.
»Fahren wir zu ihm?«, frage ich. »Zu Onkel Luther? Ich würde ihn endlich gern kennenlernen.«
»Vergiss deinen Onkel. Steig ein!«
Ich renne zur Beifahrerseite, während der Motor bereits läuft. Sie schaltet die Scheinwerfer nicht ein. Langsam rollt sie aus der Einfahrt, schaut sich mehrmals nach allen Seiten um, bevor sie aufs Gas drückt. Ich sehe nichts Ungewöhnliches, als wir die stille Straße hinunterrasen, aber ihre Finger umklammern das Lenkrad so fest, dass die Knöchel wie weiße Kiesel in der Dunkelheit leuchten
»Wohin fahren wir?«, frage ich nach einer Weile angespannter Stille, in der sie das Auto durch ein Geflecht aus Seitenstraßen lenkt, hinaus aus der beschaulichen Kleinstadt, die sie als unser endgültiges Zuhause bezeichnet hat.
Zuhause.
Als sie nicht antwortet, platze ich zornig heraus: »Du hast es versprochen! Du hast versprochen, dass wir für immer hierbleiben werden. Dass es vorbei ist!«
Sie wirft einen Blick in den Rückspiegel. »Es ist vorbei, Rica. Diesmal geht es um etwas ganz anderes.«
»Ach ja? Für mich sieht das hier aber aus wie eine Flucht. Vor wem hauen wir diesmal ab? Etwa vor Onkel Luther? Was weiß er über dich? Hast du ihm …?«
»Halte meinen Bruder aus der Sache raus.«
»Ich weiß doch gar nicht, um welche Sache es geht.« Eilig schnalle ich mich an, als der Wagen um eine Kurve schlingert und die Hinterräder ausbrechen. »Was hast du getan?«
»Nichts«, grollt sie. »Absolut nichts, das schwöre ich. Ich habe dir doch gesagt, dass ich den Job an den Nagel gehängt habe. Das war die Wahrheit.«
Ihre Nervosität springt auf mich über. Ich drücke meinen Rucksack an die Brust und schaue in den Seitenspiegel, ob uns jemand folgt. Dabei weiß ich nicht einmal, wonach ich Ausschau halten soll.
Die Stadt bleibt hinter uns zurück und ich spüre, wie sich eine altbekannte Schlinge um meinen Hals legt und sich langsam zuzieht. Sie ist aus Angst, Unsicherheit und Trauer gewebt. Die Hoffnung auf ein normales Leben zerbricht lautlos und mit ihr auch meine vagen Zukunftsträume, die ich so lange nicht zu träumen gewagt habe. Ein Schulabschluss, ein anständiger Job, Freunde, Partys und ein richtiges Zuhause … Ganz normale Dinge, die jedoch fast mein ganzes Leben lang unerreichbar waren. Bis wir hierher gezogen sind und plötzlich alles in greifbarer Nähe schien.
Jetzt sind wir wieder auf der Straße, doch diesmal ist alles anders.
Denn diesmal hat meine Mutter Todesangst.
 An einer Tankstelle mit Nachtschalter fummelt sie eine Zigarette aus einer zerknitterten Packung, während wir dem Gluckern des Benzins lauschen, das durch den Schlauch in den Tank läuft.
An einer Tankstelle mit Nachtschalter fummelt sie eine Zigarette aus einer zerknitterten Packung, während wir dem Gluckern des Benzins lauschen, das durch den Schlauch in den Tank läuft.
»Seit wann rauchst du wieder?« Ich vergrabe meine Nase im Kragen meiner zotteligen Jacke. Ein Zittern läuft durch meine Gliedmaßen; die nächtliche Kälte ist nur teilweise Schuld daran.
»Das ist meine Notfallzigarette. Ich habe sie mir für eine Gelegenheit wie diese aufgehoben.« Sie nimmt einen tiefen Zug und murmelt: »Hätte nicht gedacht, dass ich sie je brauchen werde.«
»Wo warst du heute Abend?«, frage ich. »Warum fahren wir nicht zu Onkel Luther?«
Entnervt pustet sie den Rauch aus. »Mein Bruder weiß nicht, dass es dich gibt. Dabei würde ich es gern belassen.«
»Du hast ihm nichts von mir erzählt?«, frage ich entgeistert. »Schämst du dich für mich?«
»Federica, ich habe jetzt echt keine Lust, darüber zu reden. Wir stecken in Schwierigkeiten und müssen so schnell wie möglich raus aus dieser Stadt.« Als ich sie böse anstarre, seufzt sie theatralisch. »Ich habe meinen Bruder seit über zwanzig Jahre nicht gesehen. Wir sind damals nicht im Guten auseinandergegangen und ich bin nicht davon ausgegangen, ihm je wieder zu begegnen. Er wird Fragen über deinen Vater stellen, verstehst du?«
Nein, ich verstehe es nicht. »Wer hat dich verletzt?«
Sie schaut an mir vorbei. »Zwei fremde Männer. Nachdem ich von Luther weggefahren bin, habe ich an einem Supermarkt angehalten, um Brot und Müsli fürs Frühstück zu besorgen. Deine Lieblingssorte mit den getrockneten Himbeeren. Auf dem Parkplatz – ich hatte gerade die Einkäufe im Auto verstaut und wollte einsteigen – haben sie versucht, mir die Handtasche zu entreißen. Es ging alles sehr schnell.« Sie schnippt die Zigarette fort. »Ich konnte gerade noch ins Auto springen und abhauen.«
Hastig trete ich die glühende Kippe aus, bevor am Ende noch die Tankstelle in die Luft fliegt. »Ich wusste gar nicht, dass es in unserer Stadt einen Supermarkt gibt, der nachts geöffnet hat.«
»Draußen an der Bundesstraße«, sagt sie unbestimmt. »Ich habe ihn rein zufällig entdeckt und gleich angehalten.«
Meine Mutter ist eine gute Lügnerin, aber ich erkenne die winzigen Signale, die den meisten Leuten entgehen: Ihre Finger, die ihr Kinn berühren, ihr starrer, aufrichtiger Blick …
Ich schweige, denn aus Erfahrung weiß ich, dass sie erst dann mit der Wahrheit herausrücken wird, wenn sie es will.
»Mein Bruder ist sehr wohlhabend und … sehr entschlossen. Wenn er etwas haben will, dann bekommt er es, egal auf welche Weise. Er hat keine sonderlich hohe Meinung von mir.«
»Aber er würde dir doch trotzdem helfen«, sage ich verzagt. Sie hat mir erzählt, dass er ein riesiges Anwesen besitzt, fast schon ein kleines Schloss. »Immerhin bist du seine Schwester. Er sollte sich freuen, dass du Kontakt zu ihm aufgenommen hast.«
»Es war eher umgekehrt. Und nein, er wird uns auf keinen Fall helfen.« Ihr Tonfall klingt endgültig. Sie zieht den Zapfhahn heraus, schließt den Tankdeckel und eilt zum Nachtschalter.
Ich durchsuche die Sachen auf dem Rücksitz, schaue in den Kofferraum, in dem ein paar alte Decken, das Reserverad und der Erste-Hilfe-Kasten liegen. Keine Supermarkt-Einkäufe.
Die Narbe zwischen Ring- und Zeigefinger juckt immer heftiger und ich kratze mit den Fingernägeln der anderen Hand darüber. Als ich geboren wurde, waren diese beiden Finger zusammengewachsen und sie mussten in einer kleinen Operation getrennt werden. Die weiße Linie ist kaum noch zu erkennen. Doch wenn die Narbe zu jucken beginnt, ist das immer ein schlechtes Omen.
Ich sehe, wie meine Mutter mit dem Nachtkassierer der Tankstelle diskutiert und kurz darauf zum Bankautomaten nebenan hastet. Gleich darauf tönt ein »Verdammte Scheiße!« durch die Nacht. Sie läuft zu mir zurück, die Lippen so fest zusammengepresst, dass sie einen schmalen weißen Strich bilden.
»Das ganze Geld ist weg«, stößt sie hervor.
»Wie: weg?«
»WEG!«, schreit sie. »Mein Konto ist komplett leer. Ich kann nicht einmal das Benzin bezahlen!« Sie schaut zum Kassenschalter hinüber. »Der Tankwart wird die Polizei rufen.«
»Oh Fuck«, murmele ich, denn ich weiß genau, was dann geschehen wird. »Aber wie kann das ganze Geld einfach verschw …?«
»Wir sollten uns jetzt lieber überlegen, wie wir von hier verschwinden können.« Sie deutet mit dem Kopf zu den Überwachungskameras, auf denen unser Nummernschild schön deutlich zu sehen ist.
»Hast du noch Bargeld?«, frage ich.
»Zweihundert, höchstens. Die werden wir zum Überleben brauchen.« Nervös wischt sie sich über die Lippen, wieder und wieder, bis ich fürchte, dass sie sie wund reibt.
Es ist nicht das erste Mal, dass wir mitten in der Nacht aus einer Stadt fliehen, doch sie hat es bisher immer wie ein großes Abenteuer aussehen lassen. Weil es genau das für sie war: Ein aufregendes Spiel, aus dem sie grundsätzlich als Siegerin hervorging. Nie habe ich sie verängstigt erlebt. Sie wusste genau, was sie tat.
Und wir wurden nie erwischt.
Aber sie hat ihre Tätigkeit vor über einem Jahr an den Nagel gehängt, deswegen verstehe ich nicht, was hier vor sich geht.
»Ich habe Geld«, sage ich.
»Die paar Kröten von deinen albernen Aushilfsjobs nützen uns gar nichts. Behalte dein Kleingeld.« Sie merkt nicht einmal, wie harsch ihre Worte klingen.
Mit grimmiger Miene beuge ich mich ins Wageninnere und krame in meinem Rucksack, bis ich das Blechkästchen finde. Ich zerre das Gummiband ab, öffne den Deckel und zeige ihr mit gefletschten Zähnen den Inhalt. »Sieht das für dich aus wie Kleingeld?«
Sie starrt auf die Scheine, die über den Rand quellen. Jede Menge Fünfziger, Hunderter und Zweihunderter, fest zusammengepresst und gefaltet, damit sie in das Kästchen passen.
»Du meine Güte«, murmelt sie. »Woher hast du …?« Sie schaut mich forschend an, als wäre ich eine Fremde. Langsam sagt sie: »Offenbar habe ich unterschätzt, welche Trinkgelder eine schwarz arbeitende Jugendliche einheimsen kann.«
Wir beide wissen genau, dass ich dieses Geld nicht durch Kellnern eingenommen habe. Den Blick gesenkt, schließe ich den Deckel und überlege fieberhaft, wie ich ihr erklären soll, woher …
»Wie viel ist das?«
»Ich habe es nicht gezählt.« Bevor ich es mir anders überlegen kann, drücke ich ihr das Kästchen an die Brust. »Aber es wird für eine Weile reichen, wenn du mir sagst, was du jetzt vorhast.«
Sie nimmt ein paar Scheine heraus, bevor sie es mir zurückgibt. »Erst mal müssen wir weit weg von hier.«
Beklommen beobachte ich, wie sie die Tankrechnung bezahlt. Als sie zurückkommt, sieht sie mich immer noch auf diese unangenehme Art an, die mir das Gefühl gibt, sie enttäuscht zu haben.
»Du hast also Geheimnisse vor mir«, murmelt sie und schwingt sich hinter das Steuer.
»Du doch auch.«
»Aber ich habe geglaubt, dass du die Gute, die Anständige von uns beiden bist. Das komplette Gegenteil zu mir.« Mit einem freudlosen Lachen startet sie den Motor. »So kann man sich täuschen.«
Ich umklammere das Blechkästchen mit beiden Händen und bilde mir ein, dass es mir die Finger verbrennt. Am liebsten möchte ich vergessen, dass dieses Geld existiert. Es ist schmutzig und es lacht mir höhnisch ins Gesicht.
»Bist du sauer auf mich?«, frage ich, als die Stille zwischen uns die Luft stickig macht.
»Quatsch. Du rettest uns das Leben mit deinem geheimen Geldschatz. Ich will auch gar nicht wissen, was du dafür getan hast.« Sie blinkt und lenkt den Wagen auf die Autobahn, wobei sie ständig in den Rückspiegel schaut. Leise, sodass ich mich anstrengen muss, um sie zu verstehen, fügt sie hinzu: »Ich dachte nur … Na ja, dass du niemals die gleichen Fehler machen wirst wie ich, sondern die richtigen Entscheidungen triffst. Als Mutter bin ich eindeutig eine Niete.«
»Bist du nicht.« Ich ziehe die Schultern hoch.
Sie schnaubt. »Dieses Geld, das du in der Blechdose gesammelt hast … Du willst mich verlassen, stimmt’s?«
»Nein!«, rufe ich schockiert aus – und auch etwas schuldbewusst. »Ich bin doch erst sechzehn! Wohin sollte ich auch gehen?«
»Ich verstehe es, Rica. Das Leben, das ich dir zugemutet habe, ist falsch, falsch, falsch. Ein junges Mädchen braucht Beständigkeit und Sicherheit. Ich hätte den Job schon viel eher an den Nagel hängen sollen, statt mein Glück bis aufs Äußerste auszureizen.«
»Fliehen wir vor einem deiner Jobs?«
Wir nennen das Kind nie beim Namen, reden immer nur von Jobs.
»Nein, damit habe ich aufgehört. Endgültig.«
Ich glaube ihr. Seit wir in das hübsche Apartment gezogen sind, hat sie nicht ein einziges Mal nach einem neuen Zielobjekt Ausschau gehalten, hat keine Vorbereitungen für einen Job getroffen. Als sie mir dann noch erzählte, dass sie ihren Bruder wiedergefunden hat – oder er sie –, da hatte ich wirklich ein gutes Gefühl.
»Das Geld habe ich gespart für den Tag, an dem ich herausfinde, was ich mit meinem Leben anfangen will«, sage ich langsam. »Viele Möglichkeiten habe ich ja nicht, ohne Schulabschluss.«
»Du brauchst keine Schule. Du bist klug und liest all diese Bücher und ich wette, du bist richtig gut in Geografie. Also sag mir, welcher Ort am weitesten von hier entfernt ist.«
»Terra Cimmeria«, brumme ich. »Das liegt auf der südlichen Hälfte des Mars. Man benötigt nur Sauerstofftanks und eine mobile Druckkammer, um dort zu überleben.«
»Nicht nur klug, sondern obendrein sarkastisch.« Sie grinst. »Du wirst auch ohne Schulabschluss bestens zurechtkommen.«
Ich seufze. »Wie wäre es mit Barcelona? Ich wollte schon immer mal nach Spanien.«
»So schnell kann ich keine sauberen Pässe für uns organisieren, außerdem würde es uns ein Vermögen kosten, das wir gerade nicht haben.« Sie schüttelt den Kopf. «Nein, wir müssen zuerst dieses Auto loswerden, anschließend werden wir irgendwo für eine Weile abtauchen. In einer Großstadt, in der wir noch nie waren.«
»Steenport«, schlage ich vor.
»Zu riskant. Steenport ist in der Hand einer mächtigen Gang. Man kann nie wissen, mit wem die in Kontakt stehen.«
»Zum Beispiel mit den Leuten, vor denen wir geflüchtet sind?« Ich schaue in den Rückspiegel. Um diese Zeit ist die Autobahn fast leer. »Wer sind sie?«
Natürlich schweigt sie.
»Wir müssen mitten in der Nacht unser Zuhause verlassen, aber du willst mir nicht verraten, warum?«, fauche ich. » Das ist nicht fair! Du hast versprochen …«
»Ich weiß, was ich versprochen habe!«, schreit sie zurück. Sie atmet durch, dann fährt sie mit erzwungener Ruhe fort: »Je weniger du weißt, umso sicherer für dich.«
»Wieso ist dein ganzes Geld weg?«
»Ich weiß es nicht«, presst sie hervor. »Es tut mir leid, Rica. Ich konnte doch nicht ahnen … Alles wird gut werden. Wir werden irgendwo eine neue Wohnung finden. Ich kriege das hin.«
»Also kehren wir nicht zurück.« Mein Herz sackt herab wie ein Stein.
Ich mag unser kleines Apartment. Zum ersten Mal hatte ich ein Zimmer nur für mich, das ich einrichten konnte, wie ich wollte. Ich habe mich dort sicher gefühlt. Enttäuschung steigt in mir auf und mischt sich unter die Beschämung, weil meine Mutter nun von meinem geheimen Geld weiß. Weil sie nicht wissen will, woher es stammt, und ich deswegen heilfroh bin. Denn ich will ein gutes, ein ganz normales Mädchen sein!
»Was hältst du von Sothom?«, frage ich. »Du weißt schon: The City of Underground.« Ich male imaginäre Anführungszeichen in die Luft. »Da waren wir noch nie. Die Stadt liegt am entgegengesetzten Ende des Landes.«
»Sothom!«, stößt sie aus. »Auf keinen Fall! Das ist der letzte Ort, wo ich sein möchte.«
»Es ist eine Großstadt. Perfekt geeignet, um eine Weile unterzutauchen.«
»Sothom wurde auf unheiligem Grund erbaut, heißt es.« Meine Mutter schürzt die Lippen.
»Du meinst die Katakomben? Das sind doch bloß Tunnel.«
»Und ich hasse Tunnel. In diesem unterirdischen Labyrinth sollen angeblich Geisteskranke, Mörder und mutierte Ratten hausen. Vielleicht Schlimmeres.«
»Die Katakomben sind doch gar nicht zugänglich.«
Ihre Reaktion verwundert mich. Erstens kennt sie Sothom überhaupt nicht und zweitens lässt meine Mutter sich niemals einschüchtern, schon gar nicht von wilden Gerüchten.
»Ich habe mal ein Youtube-Video über unheimliche Orte gesehen, in dem auch über Sothoms Unterwelt berichtet wurde«, sage ich. Alles, was mystisch und geheimnisvoll ist, zieht mich magisch an. Wenn man fast sein ganzes Leben lang kein richtiges Zuhause hatte, richtet man sich in der Fantasie häuslich ein. »Angeblich sind viele Menschen in den Katakomben verschollen, deswegen wurden sämtliche Zugänge schon vor Jahrzehnten verschlossen. Niemand weiß, was sich dort unten verbirgt, aber es gibt jede Menge gruseliger Geschichten.«
»Barcelona klingt erheblich attraktiver«, brummt meine Mutter. »Sonne, Wein und feurige hombres generosos.« Sie zuckt zusammen, als hinter uns Scheinwerferlicht auftaucht. Abrupt biegt sie ab, ohne zu blinken, und atmet erst auf, als der Wagen hinter uns geradeaus fährt. »Sothom ist ein gigantisches Drecksloch, das von noch größeren Dreckskerlen beherrscht wird. Wir werden schon irgendeinen anderen Ort finden, wo …« Sie verstummt.
»Wo wir sicher sind?«, frage ich vorsichtig. »Vor wem?«
Sie schlägt auf das Lenkrad. »Wir sind nirgendwo sicher!«, schreit sie.
Ich ziehe die Schultern hoch.
»Entschuldige, Süße.« Sie atmet durch. »Wir schauen einfach, wohin der Wind uns weht. So wie früher, nicht wahr?« Trotz ihres Bemühens, fröhlich zu klingen, höre ich deutlich die Verzweiflung in ihrer Stimme.
Die Narbe zwischen meinen Fingern juckt wie verrückt, als wollte sie mich warnen, dass wir geradewegs in unser Verderben fahren.
Hätte ich doch nur auf diese Vorahnung gehört.


